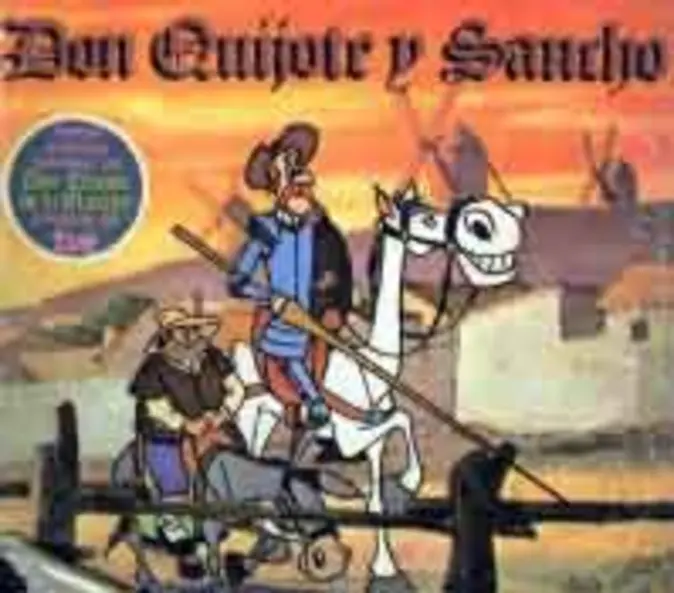Ein Streifzug durch die verschiedenen Genres der Adaptionen stand im Mittelpunkt des Bamberger Quijote-Tages. (Bild: Fertl)
Spanisches Nationalerbe
„En un lugar de la Mancha“ – So beginnt der erste Teil des “Don Quijote de la Mancha” von Miguel de Cervantes, der 1605 veröffentlicht wurde. Der zweite Teil sollte 1615 folgen. Anlässlich des 400. Jahrestages der Veröffentlichung des “Don Quijote” ist nicht nur Spanien mit zahlreichen Vorträgen, Ausstellungen und Kolloquien in Festtagslaune. Die Studiendekanin der Fakultät der Sprach- und Literaturwissenschaften, Prof. Dr. Miorita Ulrich, wollte auch vor Ort in Bamberg die Wichtigkeit dieses Werkes illustrieren. Daher fand am 10. und 11. November eine sogenannte “Jornada quijotesca”, ein Quijote-Tag, statt. Eine Veranstaltung, die sich aber kaum um den literarischen “Don Quijote” an sich drehte, sondern die Kreise aufzeigen wollte, die das Werk in seiner Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte gezogen hat. Dem Leiter des Lehrstuhls für Romanische Literaturwissenschaft, Prof. Dr. Marco Kunz, gelang es, hierfür kompetente Lektoren aus dem Ausland zu gewinnen.
Der Don Quijote auf der Bühne
Prof. Dr. Tobias Brandenberger von der Universität in Basel brachte den Studierenden den Don Quijote auf der Opernbühne nahe. Da diese musikalisch Adaption vielen Studierenden bisher unbekannt war, lautete die Kernfrage: „Wie wird ein Urtext zu einem Operntext, zu einem Libretto?“ Denn es ist das Libretto, welches die musikalische Komposition determiniert. Weniger offensichtlich ist aber, in welchem Maß ein Librettist auf den Originaltext zurückgreift. Brandenberger gelang es dennoch auf pragmatische Weise zu demonstrieren, dass die musikalische Interpretation des Don Quijote-Stoffs oft auch sehr frei sein kann. Seine Beispiele bezog er dabei ausschließlich von den romanischen Sprachen und führte das Publikum durch eine musikalische Zeitreise des Don Quijote vom 18. bis zum 21. Jahrhundert.
So schlüpft Cervantes Protagonist einmal in die Rolle des virtuosen Helden, wie beispielsweise in Joseph Bodin de Boismortiers „Don Quichotte chez la Duchesse“ (1743), oder will am Ende von Cervantes selbst den Grund für sein Scheitern wissen, wie in der zeitgenössischen Inszenierung „Don Quijote“ von Cristóbal Halffter aus dem Jahr 2000.
Für Kunz war es wichtig, diese Relationen auf die zeitgenössische spanische Literatur zu übertragen. Der „Don Quijote“ ist für ihn ein ansteckender „Pollen, der sich auf der ganzen Welt verbreitet.“ Es sei verständlich, dass das Buch als spanisches Nationalerbe gesehen wird. Dabei bestehe aber auch die Gefahr, dass der Text an sich in Vergessenheit gerät und nur dessen Autor für immer in Erinnerung bleibt. Kunz fordert, dass Autoren nicht mehr über Miguel de Cervantes an sich, sondern von ihm ausgehend schreiben. Eine Forderung, die das Werk in den Mittelpunkt stellen soll und die er als „Cervanteo“ bezeichnet.
Sprechen über Sprache
Der „Don Quijote“ war und ist bis heute ein Meilenstein der Weltliteratur. Bereits wenige Jahre nach der Erstveröffentlichung erschienen zahlreiche Übersetzungen. Die erste deutsche Übersetzung datiert bereits aus dem Jahr 1648; die erste chinesische Übersetzung erschien erst 1978. Pionierarbeit leistete auch Prof. Dr. Miorita Ulrich. Sie stellte sich der Herausforderung, das Sprechen über Sprache im Don Quijote zu analysieren. Die Sprache als Ausdruck gesellschaftlicher Zugehörigkeit wird insbesondere in der Sprache des treuen „Knappen“ Sancho Panza deutlich. Seine Ungebildetheit und Provinzialität zeigt sich in hier: Bestimmte Worte sind ihm fremd, wodurch er viele Bezeichnungen einfach verwechselt. Dies natürlich sehr zur Belustigung seines Herren Don Quijote. „Wir erhalten, und dies ist im Abstand der 400 Jahre umso bedeutender, über den Roman selbst als Sprachdokument hinaus eine Sprachreflexion und -diskussion, die sprachhistorische Auskünfte über Sprachstand, Sprachnorm und Sprachverwendung geben“, resümierte Ulrich.
Quijospourri
Der Streifzug durch die verschiedenen Genres der „Don Quijote“-Adaptionen endete mit audiovisuellen Eindrücken. Der zweite Gastleser der Tagung, Prof. Dr. Harm den Boer aus Amsterdam, zeigte in einem „Quijospourri“ die verschiedenen Möglichkeiten der Verfilmung. Besonders beeindruckt muss die Cineasten wohl die Komplexität und Vielschichtigkeit der Handlung und der reale Handlungsort der „la Mancha“ haben: Die Beispiele reichten von einer eher komödiantischen Verfilmung aus dem Jahr 1947 bis hin zu einer des nordamerikanischen Regisseurs Orson Welles, der diese als „Hommage“ an das Land sieht, in dem er sich gerne für immer niedergelassen hätte.
Da sich die meisten Tagungen eher an ein hochspezialisiertes Fachpublikum richten, stellte der Quijote-Tag ein absolutes Novum dar. Die durchweg positive Resonanz zeigt, dass dieses Novum aber keine Ausnahme bleiben sollte.