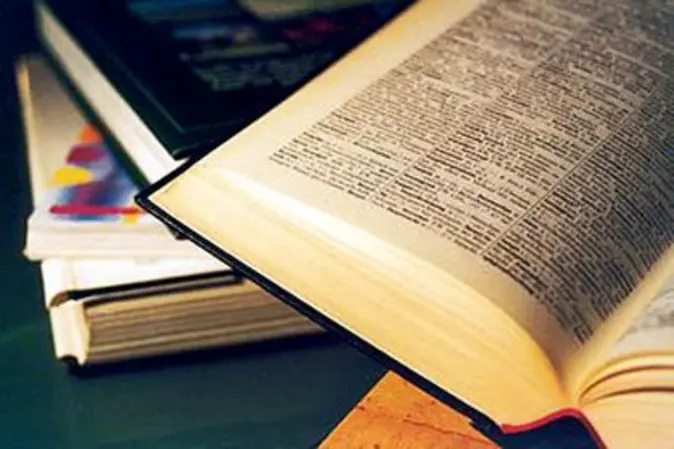Gegenwartsliteratur fast zum Anfassen bietet die Reihe "Literatur in der Universität" (Bild: photocase)
Nichts so wie es war und doch ganz wahr
„Generation Trabant“ oder „Neue deutsche Lesbarkeit“ – was sich hinter solcherlei plakativen Schlagwörtern versteckt, erlebte am 31. Mai seine Inkarnation: Julia Schoch, bekennende „Schriftstellerin des Ostens“, las an der Universität.
Sie selbst gehe nur ungern zu Lesungen, gestand Julia Schoch. „Es ist schwer, den Texten so zu folgen, dass man dem Autor gerecht wird – man fängt ja auch an zu träumen“, lacht die Potsdamerin. Dennoch wagte die 32-Jährige mit dem Bamberger Publikum vergangenen Mittwoch einen Versuch: sie lesend, die Studenten lauschend. Allerdings konnte man ihre Bedenken verstehen – zumal sie selbst sehr dicht und konzentriert schreibt, den „langen Atem“ vielhundertseitiger Prosatexte oft als „Geschwätzigkeit“ ablehnt. Ob beim simplen Zuhören ihre volle schriftstellerische Güte zu begreifen war, das bleibt zu bezweifeln; doch immerhin bekam das Publikum eine Ahnung von den harschen Wahrheiten hinter scheinbar lapidaren Erlebnisberichten und glasklaren Beobachtungen ihrer Erzählungen und damit Appetit auf Lektüre: Der Büchertisch war nach der Lesung gut frequentiert. „Lesen würde ich sie gerne“, meinte ein Gast beim Bücherkauf.
Publikum nicht alleingelassen
Die Autorin, die 2005 den zweiten Preis der Jury beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb bekommen hatte, stand unaufdringlich, aber patent hinter dem Mikrophon – und forderte durch so eindringliches wie sprödes Rezitieren ihr Publikum. Vielleicht merkte man ihr an, dass sie als Romanistikdozentin gewohnt ist, zu Studenten zu sprechen – auf alle Fälle ließ sie das Publikum mit ihren Texten nicht alleine, sondern führte ihre Lesung erklärend ein.
Bevor sie die Erzählung „Schlagen im Vorübergehen" aus der Anthologie "Beste deutsche Erzähler 2002" vorlas, bemerkte sie: "Schön, dass Geplantes auch zustande kommt". Gemünzt war dieses Lob auf den Gastgeber, Prof. Dr. Friedhelm Marx, den sie vor einem Jahr auf einer Lesung kennen gelernt und ihm einen Besuch in Bamberg versprochen hatte. Nun, im Rahmen der Veranstaltung "Literatur an der Universität" – eine Reihe, die von Prof. Dr. Wulf Segebrecht, der ebenfalls im Publikum saß, gegründet worden ist – lud Professor Marx vom Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturwissenschaft Julia Schoch an die Universität zur Lesung ein.
Literarisches Interesse an Mittäterschaft
In seiner Vorlesung zur deutschen Gegenwartsliteratur hatte Professor Marx Julia Schoch am Vortag als Autorin der „Neuen deutschen Lesbarkeit“ und der so genannten „Generation Trabant“ vorgestellt. Dieses streitbare Etikett ist gemünzt auf ostdeutsche Autoren, die ihre DDR-Erfahrung in Literatur verarbeiten. So spielte Schochs erfolgreiche Erzählung „Der Körper des Salamanders“ in einer ostdeutschen Sportausbildungsstätte vor der Wende. 1989, so begründet Julia Schoch ihr nachhaltiges literarisches Interesse am Osten, sei sie alt genug gewesen, um die politischen Ereignisse verstehen zu können, jung genug um nicht aktiv darin verwickelt zu sein und allerdings wiederum alt genug, um potenziell Täter gewesen zu sein. Und diese Vorstellung von potenzieller Mittäterschaft sei es, die literarisch attraktiv sei. „Ich zergehe ja nicht in der schnöden, mich entmannenden Vergangenheit“, meinte Julia Schoch, die bislang nicht nur lange im Osten, sondern auch im Westen gelebt hat. Sie wolle vielmehr mit dieser Vergangenheit spielen und Kontinuitäten begreifen – jenseits von Ost und West. Vergangenheit wird dabei literarisch transformierte Wirklichkeit, die für die Autorin selbst danach nicht mehr objektivierbar ist. „Fragt man mich, wie es damals war, so weiß ich nie, ob ich mich an die Wahrheit erinnere oder an meine erzählte Wirklichkeit.
Schreiben verändert Wahrheit, bringt aber das, was unter der erlebten Schicht liegt, hervor. Das kann der objektiven Wirklichkeit natürlich widersprechen“, sagt sie, für die das Schaffen von „Räumen, in die Leser ihre Emotionen geben können“ wichtiger ist als das Abbilden von Realität. „Das Angenehme an Literatur ist, dass man nichts so schreiben muss, wie es war – und doch ist es ganz wahr“, meint Julia Schoch und lacht.
„Was für die Niete tun“
Nicht wahr an dem vorgetragenen „Schlagen im Vorübergehen“ ist, dass die Autorin selbst in einem Sommercamp in der DDR gewesen war. Denn dort spielt die Erzählung des Mädchens, das mit ihrem Bruder, einem Soldaten, genannt „Niete“, die Ferien verbringt. Geschildert wird das langsame Zugrunderichten einer sensiblen Existenz durch gezieltes Mobbing. Die zwei Welten – die der Kinder einer- und der Soldaten andererseits – durchdringen sich wechselseitig, die Metapher des Spiels, die zwischen Unbekümmertheit und Ernst changiert, bringt zusammen, was in der Realität durch einen Maschendrahtzaun sauber voneinander getrennt zu sein scheint. Das literarische Interesse Schochs an der potenziellen Mittäterschaft – das konnten die Zuhörer am Beispiel des Mädchens gut nachvollziehen.
Vom Verschwinden
Die kürzere Erzählung „Über die Brachen“, die Julia Schoch anschließend vorlas, handelt vom Verschwinden. Zunächst verschwinden die Menschen von den Orten ihrer Kindheit. Als sie dorthin zurückkehren, haben sich allerdings „die Orte abgewandt“ und die Menschen sind nun die Verlassenen.
Verlassen musste Julia Schoch dann auch Bamberg – doch verschwunden ist sie nicht aus den Köpfen des Publikums, das sie mit Erzählungen und Gesprächsbereitschaft für ihre Literatur begeistern konnte. Ersichtlich war dies an der Reaktion der Zuhörer nach der Lesung: Das anfänglich zögernde Schweigen war schnell überwunden, und es kamen immer mehr Fragen aus dem Publikum – sei es nach ihrer Poetik, Schreiberfahrung, Themensuche oder den beklemmenden Erlebnissen in Klagenfurt bei der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises, dem Urteil der Jury ausgeliefert.