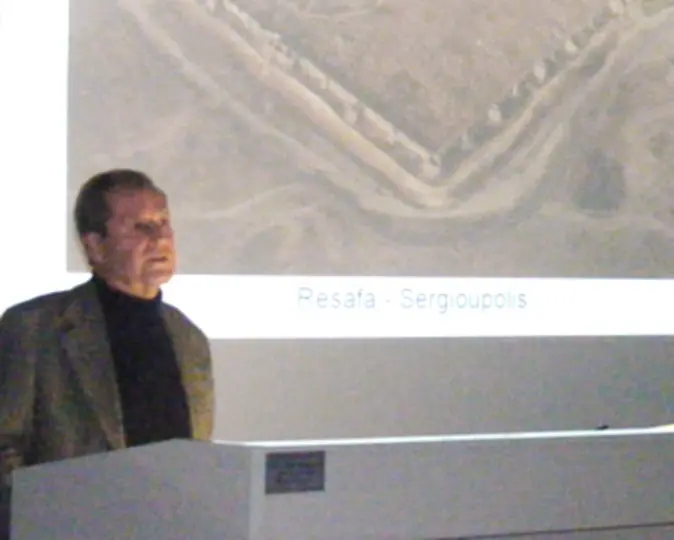Blick auf die verlassene syrische Wüstenstadt Resafa-Sergiupolis (Foto: Professur für Archäologie der Römischen Provinzen).
Tilo Ulbert referiert über Ausgrabungsfortschritte in Resafa-Sergiupolis (Fotos: Lydia Hendel).
Die Organisatoren des Archäologischen Kolloquiums mit dem Referenten (v.l.n.r.): Lorenz Korn, Tilo Ulbert, Michaela Konrad, Andreas Schäfer.
Resafa-Sergiupolis und seine 1200-jährige Geschichte
Das 3. Jahrhundert nach Christus: Systematische Christenverfolgungen prägten das römische Reich. In der Wüstenstadt Resafa – Sergiupolis fand auch der Christ und Offizier Sergius den Tod. Posthum wurde er zum Märtyrer erhoben. 1700 Jahre später ist der Ort seines Grabes archäologischer Forschungsgegenstand. Tilo Ulbert referierte beim Archäologischen Kolloquium über die Ausgrabungsfortschritte.
Eine Szene, wie sie typisch für den Wallfahrtsort unweit des Euphrats war: Viele Menschen reisen zur zentralen Basilika der Stadt Resafa – Sergiupolis, der letzten Ruhestätte des Märtyrers Sergius. Sie hoffen, einige Tropfen des kostbaren, durch den Sarkophag an den Gebeinen des Märtyrers vorbei geflossenen Öls zu ergattern. Zahlreiche in den trockenen Boden eingetretene Münzen, Glassplitter, Schmuckgegenstände und Graffiti belegen den damaligen Zulauf der Gläubigen in die heute formal als „Basilika A“ bezeichnete Hauptkirche der Stadt. „Diese Fundstücke ermöglichen eine annähernde Datierung und Rekonstruktion des Wallfahrtsgeschehens in der Kultstätte“, erläuterte Prof. Dr. Tilo Ulbert. Er leitete das Projekt von 1975 bis 2005 und war Direktor der Abteilungen Damaskus und Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts.
Rekonstruktion der Stadtgeschichte
Am 1. Dezember 2009 referierte Ulbert beim Archäologischen Kolloquium über die Ausgrabungsfortschritte in der Wüstenstadt. Unter dem Titel „Resafa – Sergiupolis. Eine Stadt in Syrien zwischen Spätantike und Mittelalter“ informierte er über die Entwicklung des Ortes von einer reinen Militäranlage des 1. Jahrhunderts hin zu einem urbanen, mittelalterlichen Zentrum mit zahlreichen profanen und sakralen Strukturen.
Nach der Zerstörung Resafas im 13. Jahrhundert ragen heute die aus Gipsstein errichteten meterhohen Überreste von Stadtmauer, Türmen und Toren imposant aus der flachen Landschaft. „Die äußerst witterungsanfälligen Zeugnisse von Verteidigungs-, Kult- und Versorgungsanlagen erfordern langfristig einen aufwändigen Denkmalschutz“, erklärte Ulbert. „Zunächst arbeiten die Wissenschaftler jedoch an der archäologische Freilegung und einer detaillierten Dokumentation.“
Seit den 1950er Jahren befassen sich verschiedene deutsche Forschungsteams des Deutschen Archäologischen Instituts in Kooperation mit anderen Einrichtungen – so auch der hiesigen Professur für Archäologie der Römischen Provinzen - im Bereich des römischen Limes im nördlichen Syrien und in Resafa mit dieser Aufgabe. Gezielt wurden dabei die Grenzen der römischen Expansion und Befestigungen sowie die historische Entwicklung des Raumes bis zum Mongoleneinfall 1257 herausgearbeitet. Ulbert griff einige Stationen dieser Rekonstruktion auf und verwies auf die lokalen, von den naturräumlichen und sozialen Gegebenheiten bestimmten Besonderheiten, darunter auch die imposanten, kathedralenartigen Zisternen, die das Leben in der Wüstenmetropole erst ermöglichten.
Friedliches Aufeinandertreffen zweier Religionen
So wurde beispielsweise nach der arabischen Eroberung Resafas im Jahre 636 eine Moschee mit zwei Durchgängen in den christlichen Bereich der Basilika A direkt an die Mauer des bestehenden Sergiusmartyrions angesetzt. Damit residierten der christliche Metropolit und der islamische Mufti in unmittelbarer Nachbarschaft. „Ein Beleg nicht nur dafür, dass religiöse und profane Aktivitäten nebeneinander ausgeübt wurden, sondern vor allen auch für den großen Respekt gegenüber dem Sergiuskult“, stellte Ulbert fest. „Immerhin erwähnten auch arabische Schriftsteller die christlichen Kultbauten in Sergiupolis.“
Ulberts Vortrag machte dank dieser anschaulichen Schilderungen nicht nur die jahrhundertealte Geschichte der syrischen Pilgerstadt wieder lebendig, sondern dokumentierte auch, welche bedeutenden Erkenntnisse die Ausgrabungen zur Erforschung der römischen Ostgrenze, der byzantinischen Blütezeit der Stadt als Wallfahrtsziel zum Grab des Märtyrers Sergius sowie zur frühislamischen Epoche Syriens lieferten.
Weitere Informationen zum Archäologischen Kolloquium finden Sie ![]() hier.
hier.