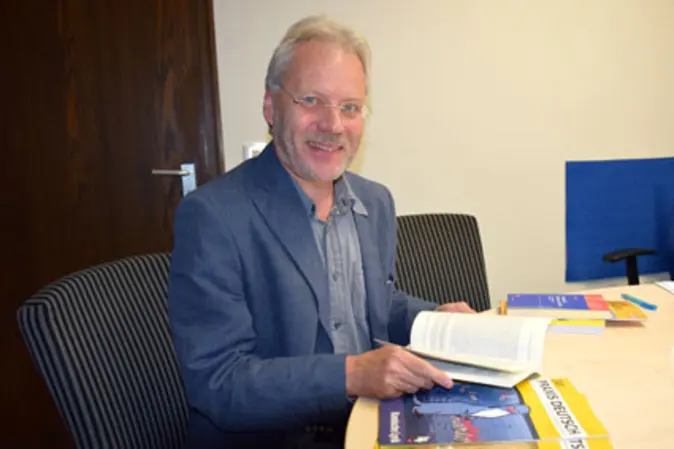Persönlichkeitsbildung als Erziehungsauftrag
Das Fach Deutschdidaktik nimmt eine Vermittlerrolle zwischen Erziehungs- und Fachwissenschaft ein. Der neu berufene Lehrstuhlinhaber für Deutschdidaktik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Prof. Dr. Ulf Abraham, zeigte in seiner Antrittsvorlesung auf, wie sein Fach nicht nur die Ausbildung der angehenden Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer anleite, sondern auch zur Persönlichkeitsbildung anrege.
Ulf Abraham begann seinen Vortrag mit einem recht außergewöhnlichen Textbeispiel: Eine junge Lehramtsstudentin berichtet von ihren ersten Erlebnissen in der für sie neuen Universitätswelt. Trotz überfüllter Hörsäle, voller Einschreibelisten und des ungewohnten Umfelds fasst sie neuen Mut und stürzt sich letztlich entgegen aller Anfangsschwierigkeiten ins Studium. Für Ulf Abraham stellt dieser Weg jedoch fast schon die Ausnahme dar: Der Deutschdidaktiker, der selbst Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert hatte, kritisierte in seiner Antrittsvorlesung am 2. Mai die häufig anzutreffende Unaufgeschlossenheit der Lehramtsstudierenden: „Viele möchten nur Rezepte für die Behandlung von Schülern aufgetischt bekommen“, folgerte er. Doch seiner Meinung nach zählen für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer weit mehr noch als die fachliche Kompetenz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale: Neben Motivation listete Abraham hier vor allem die Fähigkeit zur Selbststeuerung und zur Verantwortungsübernahme auf. Wie könne man aber zu solch einer Lehrerpersönlichkeit werden? Weit jenseits dessen, was man vom fachdidaktischen Unterricht eigentlich erwarten würde, forderte Abraham, die Studierenden dahingehend zu fördern, zuallererst das Zuhören zu lehren und in ihnen die Neugierde am Schüler zu wecken. „Das Fach Deutsch ist ein kommunikatives Fach“, betonte Abraham. Einseitigkeit sei sowohl in der Unterrichtsgestaltung, vielmehr aber noch im Umgang der zukünftigen Lehrer mit ihren zukünftigen Schülern definitiv fehl am Platze.
Kein Schüler weit und breit
„Kein Schüler weit und breit. Die Aufgabe bist du“ – mit diesem abgewandelten Kafkazitat überschrieb Ulf Abraham seine Antrittsvorlesung. In der Tat begegnen Lehramtsstudierende in den sieben bis zehn Semestern ihres Studiums nur selten auch wirklich Schülern. Stärkeres Engagement in den Praktika könne hier, so Ulf Abraham, Abhilfe schaffen. Zugleich betonte er aber, dass es grundlegend falsch sei, die Hochschule in eine Schule zu verwandeln. Ein großes Problem sehe er darin, dass Lehrer meistens genau so unterrichten, wie sie selbst in der Schule unterrichtet wurden. Die jahrelang geprägten Lehrer- und Schülerbilder herrschten trotz deutschdidaktischer Schulung an der Universität immer noch vor, stellte der neue Lehrstuhlinhaber heraus. Als Lösungsansatz präsentierte Ulf Abraham Ideen, um das Interesse der Germanistikstudierenden am eigenen Fach zu steigern: „Nur wer selbst weiß, wie er zu den Sprach- und Literaturwissenschaften steht, kann Deutsch auch in der Schule unterrichten und Vorbild für die Schüler werden. Nur wer Begeisterung für sein Fach empfindet, kann auch im Schüler Begeisterung wecken!“ Diese Begeisterung könne nun entfacht werden durch Creative-Writing-Veranstaltungen an der Universität, in denen die Studierenden ihre eigene sprachliche und literarische Kompetenz unter Beweis stellen könnten. Einen ähnlich integralen Teil zur Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit könnten aber auch Lese- und Schreibreisen bieten, wie sie Ulf Abrahams Lehrstuhl immer wieder anbiete. Lehrpersonal und Studierende fahren für etwa eine Woche in ‚literarisch’ geprägte Landschaften, etwa in das Tessin Herman Hesses, und wandeln dort auf den Spuren der großen und kleinen Literaten. „Hier bietet sich aber dann auch die Möglichkeit, selbst Spuren zu legen“, so Abraham: Aus der ästhetischen Erfahrung resultiert eine literarische Bildung, die die Teilnehmenden zu eigenen literarischen Schöpfungen anrege.
Am Ende seines Vortrags merkte Ulf Abraham jedoch an, dass es bestimmte Grenzen gäbe. Auch die Deutschdidaktiker könnten den angehenden Lehrern nicht alles beibringen: „Deswegen ist es wichtig“, sagte Abraham, „sich ständig als Deutschlehrender zu hinterfragen und sich selbst auch als Lernender zu begreifen, ehe man selbst lehren oder belehren will.“
Der Werdegang von Prof. Dr. Ulf Abraham
Ulf Abraham (Jahrgang 1954) studierte Deutsche und Englische Philologie in Erlangen und Freiburg/Br., legte das 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab (1980), promovierte als Stipendiat der Studienstiftung des dt. Volkes mit einer Arbeit über Recht und Schuld im Werk Kafkas (1983), arbeitete nach dem 2. Staatsexamen (1985) vier Jahre als Gymnasiallehrer, war von 1989 bis 1994 wissenschaftlicher Assistent, nach der Habilitation (1994) Privatdozent an der Universität Bamberg. Von 1995 bis 2005 hatte er den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Würzburg inne.
Im Sommersemester 2004 nahm er eine Einladung an die Emory University in Atlanta, GA (USA) wahr, um dort am Department of German Studies den Schreibdidaktiker Gerd Bräuer bei der Begründung und Einrichtung einer mehrsprachigen Online-Zeitung für Studierende und Schüler (ISJ) zu unterstützen.
Seit 2003 gehört er der Herausgeberrunde der angesehenen Zeitschrift "Praxis Deutsch" an.
2002 und 2006 ist er maßgeblich an der Ausrichtung des alle zwei Jahre stattfindenden Internationalen Symposions Deutschdidaktik beteiligt.
2005 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Bamberg.