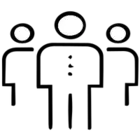
Keynotes
Hören Sie Keynotes renommierter Expert/-innen zu demokratischen Werten in Zeiten autoritärer Versuchungen und kommen Sie mit ihnen ins Gespräch.
Die Raumangabe finden Sie bei der jeweiligen Keynote.
16. Oktober 2025 (10:15 - 12:30 Uhr)
Prof. Dr. Hermann Josef Abs (Universität Duisburg-Essen)
Der Vortrag führt in die Zukunftsperspektive von Jugendlichen ein und wirft zunächst die Frage auf, welche Gestaltungsperspektive Lehrkräfte angesichts bestehender Ängste vermitteln können. Anschließend wird die Breite von Demokratiebildung in der Schulentwicklung systematisch dargestellt. Es folgen empirische Ergebnisse aus einer internationalen repräsentativen Studie, an der in Deutschland zwei Bundesländer teilgenommen haben. Dabei wird auf unterschiedliche Aspekte der Demokratiebildung (politisches Wissen, kontroverses Diskutieren, Sich-Beteiligen und Respekt) eingegangen.
Raum: M3N/02.32

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Annette Scheunpflug (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
Im Vortrag wird zunächst der Zusammenhang zwischen einem Vertrauensverlust in die Demokratie und der zunehmenden Globalisierung entfaltet. Vor diesem Hintergrund werden Überlegungen angestellt, wie Schulleitungen zu einem besseren Verständnis beitragen können und mit welchen Schritten demokratiebezogene Bildung unterstützt werden kann.
Der Beitrag baut auf empirischen Untersuchungen zur weltbürgerlichen Bildung auf, thematisiert aber weniger die empirischen Erkenntnisse selbst als vielmehr die Frage, wie schulische Bildung angesichts dieser Herausforderungen zur Demokratiebezogenen Bildung beitragen kann.
Raum: MG2/00.10
17. Oktober 2025 (9:15 - 10:15 Uhr)

Prof. Dr. Alexander Wohnig (Universität Siegen)
Der Vortrag fokussiert die drei Konzepte politische Bildung, Demokratiebildung und Demokratiepädagogik, die im Zuge gesellschaftlicher Krisenphänomene vermehrt Bedeutung zu erlangen scheinen, im Sinne eines differenzierenden Ansatzes. Dabei wird deutlich, was die Konzepte jeweils kennzeichnet, wie sie unterschieden und in der Praxis umgesetzt werden können. Ein besonderes Augenmerk legt der Vortrag auf Möglichkeiten, die in Kooperationen mit außerschulischen Akteuren für die Verwirklichung von Bildung in Form der drei Konzepte entstehen. Abschließend sollen Handlungsmöglichkeiten für Schulleitungen beschrieben werden.
Raum: M3N/02.32
17. Oktober 2025 (12:30 - 13:15 Uhr)

Dr. Felix Schreiber (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Selbstregulation entsteht nicht primär aus individueller Willenskraft, sondern aus einem unterstützenden schulischen Ökosystem. Aufbauend auf etablierten Phasenmodellen der Handlungsregulation – dem Regelkreis aus Zielsetzung, Monitoring und Anpassung – und gestützt durch eine aktuelle Stellungnahme der Leopoldina (2024), argumentiert der Vortrag, dass dieser rein kognitive Ansatz in der alltäglichen Lebenswelt an seine Grenzen stößt. Die gezielte Unterbrechung von Aufmerksamkeit durch digitale Reize ist dafür nur das prominenteste Beispiel.
Wirksame Förderung braucht daher eine Erweiterung um zwei entscheidende Ebenen:
1) Motivation: Zukunftsorientierte Gedanken und erwartete Emotionen (z. B. Stolz, Bedauern) treiben Handlungen nachhaltig an.
2) Sozialer Kontext: Ziele entfalten mehr Wirkung, wenn sie in eine positive Gruppenidentität eingebettet sind.
Für Schulleitungen heißt das: Nachhaltige Selbstregulation entsteht nur, wenn das triadische Zusammenspiel von professionell agierenden Lehrkräften, informierten Bezugspersonen und den Lernenden selbst gezielt gefördert wird. Rahmenkonzepte wie Epsteins „School, Family, and Community Partnerships“ zeigen, wie diese systemische Kooperation verankert werden kann. Schulführung wird damit zur Architektenrolle: Sie gestaltet Strukturen und Kultur, die Zusammenarbeit ermöglichen und Selbstregulation so zur gelebten Grundlage für deliberative und demokratische Kompetenz machen.
Raum: M3N/02.32