ForMaD 04.11.2025 - „Denk mal in Englisch nach, symmetrical figures!“ Empirische Einblicke in Begriffsbildungsprozesse von mehrsprachigen Grundschulkindern

Vor großem Publikum führt Dr. Rebecca Klose von der Justus-Liebig-Universität Gießen zunächst aus, wie wichtig Begriffe für das Lernen (nicht nur von Mathematik) sind. Begriffe können als Instrumente des Denkens, Sprechens und Handelns aus philosophischer Perspektive (Wittgenstein) oder aus psychologischer Perspektive (Piaget) betrachtet werden. Aus der Perspektive der kognitiven Linguistik und Semiotik (Peirce) werden Begriffe als Konzepte gedeutet. In der mathematikdidaktischen Perspektive werden diese Theorien aufgegriffen und die vielfältige Bedeutung von Begriffen ausgeschärft. Begriffe bezeichnen hier vernetztes Wissen über mathematische Objekte, ihre Beziehungen und Strukturen. dabei wird zum einen je immer eine Klasse von Objekten in Eigenschaften und zum anderen werden mathematische Tätigkeiten (inkl. Verfahren) betrachtet. Wesentlich ist mathematischen Begriffen die Notwendigkeit von Vorstellungen und Ideen, da sie nicht der direkten Anschauung zugänglich sind. Alle Zeichen und auch Wörter bedürfen der Repräsentation in Darstellungen, um Vorstellungen aufbauen zu helfen. Der Einsatz von Repräsentationen (Material, Darstellungen u.Ä.) muss Zugang zu den drei Aspekten eines Begriffs ermöglichen: Den Begriffsumfang, den Begriffsinhalt und schließlich auch das Begriffsnetz. Die Aushandlung der Ideen und Vorstellungen gelingen dabei immer im Wechselspiel zwischen Begriff, Objekt und Bezeichner.
Begriffsbildungsprozesse sind immer auch Entwicklungsprozesse. Äußerungen der Lernenden können z.B. aufgrund von ‘Stufen’ des Begriffsverständnisses nach Vollrath (Intuitiv - inhaltlich - integriert - (formal)) diagnostisch analysiert werden und somit Hinweise geben, welche aktuellen Vorstellungen vorliegen und wie diese fördernd angeregt werden können. Die von der KMK geforderte Förderung von Fachbegriffen kann, nach Klose, durch handelnde, modellhafte, materialgebundene und vor allem sprachlich beschreibende Aktivitäten unterrichtlich beantwortet werden. Fachsprache ist dabei in ihrer kommunikativen Funktion (gemeinsame Aushandlungen) also auch in ihrer kognitiven Funktion (Wissen ausbilden) wesentlich. Sie ist somit Lehr- und Lernmedium zugleich.
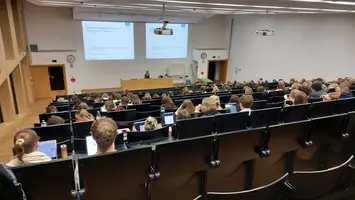
Mehrsprachigkeit als weltweites Phänomen und Merkmal deutscher Gesellschaft, stellt (Mathematik-)Unterricht vor neue Herausforderungen. Sie bietet jedoch auch Chancen, die individuelle Nutzung von mehreren natürlichen Sprachen (vgl. Oksaar, 1980) für mathematisches Lernen gezielt zu nutzen. Die zentrale Bedeutung der Sprache wird zu einem neuen Zugang zu mathematischen Begriffen und damit zu mathematischem Wissen, wenn Bildungsprozesse als Schnittmenge zwischen fachlichem und (fremd)sprachlichem Lernen interpretiert werden (vgl. CLIL Ansatz). Klose fokussiert in ihren Forschungen bilingualen Unterricht, zu dessen offiziellen Fächerkanon die Mathematik gehört. Sie stellt ihre Erkenntnisse aus einer empirischen Studie zur Untersuchung mathematischer Begriffsbildungsprozesse im bilingualen Kontext, in der Grundschulkinder PriMaPodcasts auf Deutsch und Englisch erstellt haben, vor. Die zwei Bezugssprachen bieten hier auf unterschiedlichen Ebenen (Wort, Satz, Text …) gerade durch Unterschiede Optionen, mathematisches Wissen zu erweitern. So fokussiert z. B. der deutsche Begriff Dreieck auf die Eigenschaft der Ecken, wohingegen der englischsprachige Begriff triangle auf die Winkel verweist. Klose weist nach, dass die Kinder kreativ mit beiden Sprachen umgehen, beliebig Springen zwischen den Sprachen oder sogar Worte neu erfinden. Von besonderer Bedeutung sind auch non-verbale Kommunikationsmittel wie Geste und paraverbale Mittel wie Betonungen. Sie kann einen Zusammenhang zwischen Interaktions- und Kommunikationsprozessen und Verstehen identifizieren. Insbesondere kann sie die Tandem-Interaktion (immer zwei Kinder haben zusammen einen Podcast erstellt), die Bereitstellung von Material (z.B. geometrische Körper aus Holz) sowie die im Ablauf fest integrierte Phase der Rückmeldungen durch die Lehrkraft und durch andere Kinder als wesentliche Einflussfaktoren herausarbeiten.
Leseanregungen
- Klose, R. (2022). Mathematische Begriffsbildung – PriMaPodcasts im bilingualen Kontext. Waxmann. https://www.waxmann.com/buecher/Mathematische-Begriffsbildung
- Baschek, E., Fetzer, M., Klose, R., Schreiber, Chr. & Söbbeke, E. (Hrsg.) (2024). Sprachlich-kulturelle Ressourcen im Mathematikunterricht der Primarstufe (MaRLen – Mehrsprachigkeit als Ressource beim Lernen von Mathematik nutzen, Bd. 1). WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872867.0
- Klose, R. (2023). Begriffe bilden – aber wie? Grundschulkinder beschreiben ihre Vorstellungen zum Würfel. Mathematik differenziert, Heft 4, 6-8.
- Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). WTM. https://doi.org/10.37626/ga9783959871969.0
- Schreiber, Chr. & Klose, R. (2017). Audio-Podcasts zum Darstellen und Kommunizieren. In Chr. Schreiber, R. Rink & S. Ladel (Hrsg.), Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe – Ein Handbuch für die Lehrerausbildung. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, 3. Band) (S. 63-88). WTM.
Mathe-Podcasts - Beispiele, Ergebnisse und Hinweise zur unterrichtlichen Durchführung
https://podcast.math.uni-giessen.de/primapodcast/ (von Kindern / für Kinder)
https://podcast.math.uni-giessen.de/mathepodcast/ (von Studierenden / für Erwachsene)

