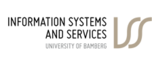Abschlussarbeiten
Vielen Dank für Ihr Interesse, am ISDL-Lehrstuhl Ihre Abschlussarbeit zu schreiben. Für einen reibungslosen Ablauf beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise. Vielen Dank.
Ablauf
1. Bitte informieren Sie sich über die möglichen Abschlussarbeitsthemen auf dieser Website und entscheiden sich für ein Thema. Das Formular darf nur nach Rücksprache mit einem Betreuer mehrfach ausgefüllt werden.
2. Bitte informieren Sie sich über die maximale Bearbeitungsdauer Ihrer Abschlussarbeit und Ihr angestrebtes Anmeldedatum. Die Anmeldung sollte innerhalb der nächsten sechs Wochen nach Anfrage erfolgen.
3. Zur Anfrage für eine Abschlussarbeit nutzen Sie bitte das Formular im unteren Teil der Website. Bitte beachten Sie dabei auch ggf. angegebene Hinweise in den einzelnen Themenstellungen.
4. Nach Abschicken des Formulars wird sich der dafür zuständige Mitarbeiter bzw. die dafür zuständige Mitarbeiterin mit Ihnen in Kontakt setzen.
Neue Themen sind seit dem 01.10.2025 ausgeschrieben!
Themen
Zukunft der Arbeit (Future Studies)
Wie werden Arbeit und Berufe der Zukunft aussehen? Welche weiteren technologischen Innovationen können helfen oder sind notwendig für weiteren Fortschritt in Qualität und Produktivität der Arbeit, und was sind die Implikationen für Menschen und Gesellschaft?
Kurzfristig werden positive und disruptive Transformationen erwartet, wie sie derzeit u.a. im Kontext von AI oder Homeoffice diskutiert werden. Längerfristig stellen sich grundlegende Fragen nach Art, Sinn und Aufgaben von Arbeit (und wer arbeitet) möglicherwiese neu. Wie wünschenswert und gestaltbar solche kurz- und langfristigen Entwicklungen sind, wird teilweise schon heute durch Entscheidungen und Regeln mitbestimmt. Daher setzt ein verantwortungsvolles Handeln, das eine Zukunft, die nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert ist, einen möglichst klaren Blick über Wege und Dynamiken in mögliche Welten voraus. Dies genau ist Gegenstand von „Future Studies“ in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und aktuell nicht zuletzt wegen der zentralen Bedeutung wirtschaftsinformatischer Themen ein starker Trend in der internationalen Wirtschaftsinformatik. Ziel der Abschlussarbeiten in diesem Themenbereich sollen entsprechend wirtschaftsinformatische Future Studies vor allem im Kontext „Zukunft der Arbeit und Arbeit der Zukunft“ sein. Mögliche Themen können
- kürzer- oder längerfristige Szenarien behandeln,
- verschiedenen Methoden wie u.a. Delphi-, Szenario- oder Simulationsstudien und Literaturanalysen verwenden,
- konkrete Technologiepfade (zB. KI, neural interfaces, robotics) oder zB. Branchenentwicklungen analysieren
- und sogar Methoden, Bewertungen, Innovationen und Darstellungsvariationen von Future Studies selbst umfassen.
Fokus von Future Studies ist dabei vorrangig gar nicht eine genaue Prognose der Zukunft, sondern stärker noch ein Verstehen, wie sich verschiedene Entscheidungen und Entwicklungen bedingen und beeinflussen, um so auch nicht offensichtliche Szenarien erkennen und bewerten und frühzeitig richtige(re) Grundlagen legen und Entscheidungen treffen zu können.
Typische Abschlussarbeitsthemen könnten demnach sein:
- Welche technischen und gesellschaftlichen Engpassfaktoren hemmen den Einsatz von KI zur sinnvollen Vollautomatisierung und wohin geht es nach ihrer Überwindung?
- Welche Methoden für Future Studies gibt es und was sind ihre Stärken und Schwächen?
- An welche Grenzen stoßen wir, wenn Moore’s Law weitere 60 Jahre hält?
- Was fehlt (neben Nanoreplikation und unbegrenzter Energie) zur Realisierung einer Star-Trek-Welt, in der es nur noch freiwillige, intrinsisch motivierte Arbeit gibt?
- Welche Bildung und Ausbildung sollte man seinen Kindern, Enkeln, Urenkeln und Ururururururenkeln empfehlen?
- Wie lässt sich das world building in guter Science-Fiction-Literatur für Future Studies nutzen?
- Welche Aufgaben und Fähigkeiten machen einen effektiven, glücklichen IT-Experten heute und übermorgen aus?
- Wie kann Work-from-Home alle Vorteile klassischer Arbeit für Arbeiter und Unternehmen bieten?
- Was ändern soziale Maschinen?
- Wie kann Rekrutierung und Partnersuche besser werden?
Startzeitpunkt: ab sofort
Methode: verschiedene Methoden möglich
Level: Bachelor/Master
Sprache: Englisch/Deutsch
WeiteresVorgehen: Eine Forschungsfrage wird mit dem Betreuer erarbeitet.
Einstiegsliteratur:
Carmel, E. and Sawyer, S. (2023). The multi-dimensional space of the futures of work. Information Technology & People. Vol. 36 No. 1, pp. 1-20. DOI 10.1108/ITP-12-2020-0857.
Chiasson, M., Davidson, E. & Winter, J. (2018) Philosophical foundations for informing the future (S) through IS research. European Journal of Information Systems, 27(3), 367-379.
Grover, V., and Segars, A. H. 1996. "IT: The Next 1100102 Years," The DATA BASE for Advances in Information Systems (27:4), pp. 45-57.
Kendall, K. E. 1997. "The Significance of Information Systems Research on Emerging Technologies: Seven Information Technologies That Promise to Improve Managerial Effectiveness," Decision Sciences (28:4), pp. 775-792.
Gray, P., and Hovav, A. 2007. "The IS Organization of the Future: Four Scenarios for 2020," Information Systems Management (24:2), pp. 113-120.
Gray, P., and Hovav, A. 2008. "From Hindsight to Foresight: Applying Futures Research Techniques in Information Systems," Communications of the Association for Information Systems (22).
Erwartungen und Technologienutzung
Die langfristige Nutzung von Technologien wird stark durch die Erwartungen der Nutzenden und deren Erfüllung oder Enttäuschung beeinflusst. Werden die Erwartungen erfüllt, führt dies zu Zufriedenheit und langfristiger Nutzung, während Enttäuschung zu Beendigung der Nutzung führt. Das Ziel der Arbeit könnte sein, die Erwartungen im Kontext umweltfreundlicher Technologien zu betrachten, die Rolle von Vertrauen gerade im Umgang mit AI-Technologien zu untersuchen oder Bewältigungsmechanismen der Nutzenden bei enttäuschten Erfahrungen herauszuarbeiten.
Startzeitpunkt: ab sofort
Methode: verschiedene Methoden möglich
Level: Bachelor/Master
Sprache: Englisch/Deutsch
WeiteresVorgehen: Eine Forschungsfrage wird mit dem Betreuer erarbeitet.
Einstiegsliteratur:
Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. MIS Quarterly, 351–370.
Brown, S. A., Venkatesh, V., & Goyal, S. (2014). Expectation confirmation in information systems research. MIS Quarterly, 38(3), 729-A9.
Tams, S., Thatcher, J. B., & Craig, K. (2018). How and why trust matters in post-adoptive usage: The mediating roles of internal and external self-efficacy. The Journal of Strategic Information Systems, 27(2), 170–190.
Ansätze zur Messung und Entwicklung einer zeitgemäßen IT-, Arbeits- und Firmenkultur
Was können und müssen Unternehmen tun, um eine zeitgemäße Kultur des Arbeitens, Kommunizierens und Miteinanderumgehens speziell für IT-nahe Berufe zu schaffen?
Seit vielen Jahren sind insbesondere Menschen mit IT- und Business-Kenntnissen – die typischen WI- und IISM-Absolventen – eine der nachgefragtesten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt. Das hat dazu geführt, dass sich Unternehmen immer stärker bemühen, mögliche Kandidaten zielgruppengerecht anzusprechen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Ein Teil der Literatur aus der langen Forschungstradition zu Berufsbildern, Fähigkeiten, Eigenschaften und Bedarfen von IT-Fachkräften (IT workers, IT talent, IT professionals) hat dabei u.a. gezeigt, dass heute „weiche“ Anforderungen die Wunschliste an einen Idealarbeitgeber dominieren und eine gesunde Arbeits-, Firmen- und Kommunikationskultur wichtige Entscheidungskriterien für die knappen Bewerber sind. Der Schwerpunkt soll daher auf einem der folgenden Bereiche liegen:
- Was sind die konkreten Bausteine einer modernen Arbeitskultur?
- Welche Maßnahmen zur Entwicklung einer guten „Kultur“ im Unternehmen gibt es und welche davon wirken nachweislich?
- Was machen Firmen, um eine zielgruppengerechte „Kultur“ im Unternehmen speziell für bestimmte Zielgruppen (WI/IT oder auch andere) zu schaffen?
- Wie kann man „Kultur“ im Unternehmen messen?
Startzeitpunkt: ab sofort
Methode: verschiedene Methoden möglich (v.a. Literaturanalyse, Fallstudien, Repertory Grid (Nutzung und Toolentwicklung))
Level: Master
Sprache: Englisch/Deutsch
Weiteres Vorgehen: Details werden mit dem Betreuer besprochen.
Methoden und Theorien in der Wirtschaftsinformatik
Die Wirtschaftsinformatik- und Information-Systems-Forschung verwendet eine zunehmend diverse Menge an Methoden und Theorien. Der Scherpunkt dieses Themenbereiches liegt in der Analyse dieser Vielfalt. Konkret sollen die meistverwendeten Theorien bzw. Methoden in der Kernliteratur der WI/IS-Community sowie in benachbarten Wissenschaftsdisziplinen (zB. strategisches Management) identifiziert werden.
Startzeitpunkt: ab sofort
Methode: verschiedene Methoden möglich
Level: Master
Sprache: Englisch/Deutsch
Weiteres Vorgehen: Details werden mit dem Betreuer besprochen.
Einstiegsliteratur:
Wilde, T., Hess, T. (2007): „Forschungsmethoden in der Wirtschaftsinformatik“, WIRTSCHAFTSINFORMATIK 49 (4), S. 280–287