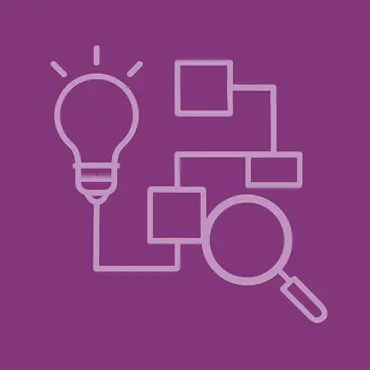InTraBau - DATIpilot (BMFTR)
Innovation aus Tradition - Transferstrukturen für nachhaltiges und klimagerechtes Bauen im Bestand und in der Denkmalpflege
Die Innovationscommunity (IC) „InTraBau“ möchte das immense Wissen, das Denkmäler und traditionelle Handwerkstechniken in Bezug auf Bautechniken, Baumaterialien, Reparaturmethoden und Wiederverwertbarkeit bieten, für die Zukunft des nachhaltigen Bauens nutzbar machen. Die Baubranche spielt eine zentrale Rolle in der deutschen Wirtschaft, ist jedoch auch einer der ressourcenintensivsten Sektoren. In Deutschland fallen jährlich etwa 230 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle an, und rund 40 % der Treibhausgasemissionen stammen aus dem Gebäudesektor. Besonders beim Abriss und dem Neubau von Gebäuden entstehen hohe „graue Emissionen“, die durch die Rohstoffgewinnung und -verarbeitung verursacht werden. Durch Globalisierung, Klimawandel und politische Unsicherheiten verschärfen sich die Herausforderungen – wie Rohstoffknappheit und Lieferengpässe. Vor diesem Hintergrund ist ein Umdenken in der Baubranche notwendig: Die Zukunft des Bauens liegt im Bestand. Eine nachhaltige Strategie muss den Fokus auf die Sanierung statt des Abrisses von Gebäuden legen. Historische Bauweisen und traditionelle Handwerkstechniken in Verbindung mit modernen Technologien bieten dabei wertvolle Lösungsansätze für eine ressourcenschonende und klimafreundliche Bauweise.
Unsere Ziele
Das Hauptziel der IC „InTraBau“ ist es, einen bedeutenden Beitrag zur Ressourcenschonung und Klimaneutralität im Bausektor sowie zur Erhaltung regionaler Baukultur zu leisten. In der Diskussion über nachhaltiges Bauen wird das Potenzial von Denkmalpflege und traditionellen Handwerkstechniken oft unterschätzt. Dabei bieten sie zukunftsfähige Lösungen, die mit modernen Technologien kombiniert werden können, um den Herausforderungen des Bausektors zu begegnen. Die IC möchte diese Lücke schließen und sowohl ökologische als auch ökonomische Nachhaltigkeit fördern, indem sie Wissen zwischen Handwerk und Forschung vermittelt. Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Sanierungskultur, die sich am „Neuen Europäischen Bauhaus“ orientiert. Durch Vernetzung und gezielten Wissenstransfer zwischen Handwerk und Forschung sollen praxisrelevante Lösungen entwickelt werden. Die IC „InTraBau“ vernetzt Akteure im Bausektor, mit dem Startpunkt Oberfranken, und fördert so Innovation und Transfer zwischen Wissenschaft, Planung und Handwerk. Die entwickelten Erkenntnisse werden der wachsenden Community zur Verfügung gestellt und über Oberfranken hinaus verbreitet, um eine langfristige Vernetzung zu gewährleisten.
Die IC „InTraBau“ fördert intensiv den Transfer von Wissen zwischen Praxis und Wissenschaft. Wichtige Akteure sind Handwerksbetriebe, Forschungseinrichtungen und Planungsexperten. Ein zentraler Aspekt ist die Etablierung von Community-Clustern, die den regelmäßigen Austausch sicherstellen. Durch Workshops, digitale Plattformen und Netzwerktreffen wird der Dialog zwischen Theorie und Praxis kontinuierlich gefördert. Ein wichtiger Bestandteil des Transferansatzes ist die Identifizierung von Praxisproblemen und die Entwicklung innovativer Lösungen, die direkt in Handwerksbetrieben angewendet werden können. Best-Practice-Beispiele werden dokumentiert und für eine breitere Anwendung bereitgestellt. Zudem wird eine enge Zusammenarbeit zwischen der akademischen Welt und den handwerklichen Betrieben gefördert, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln und gegenseitig vom vorhandenen Wissen und den langjährigen Erfahrungen zu profitieren. So wird nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks gestärkt, sondern auch der nachhaltige Umbau des Bausektors vorangetrieben.
DEUTSCHE AGENTUR FÜR TRANSFER UND INNOVATION - DATIpilot
Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) veröffentlichte im Juli 2023 die Förderrichtlinie DATIpilot mit zwei Modulen: Innovationssprints (Modul 1) und Innovationscommunities (Modul 2). DATIpilot zielt darauf ab, Förderprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Zudem fungiert das Programm als Experimentierraum sowie als Erfahrungs- und Ideenspeicher für eine verbesserte Transfer- und Innovationsförderung des Bundes.
In Modul 2 werden insgesamt 20 Innovationscommunities über einen Zeitraum von 4 Jahren mit bis zu 5 Millionen Euro gefördert. Die Communities wurden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch eine unabhängige Jury aus zwölf Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ausgewählt und konnten sich unter den über 480 Bewerbungen durchsetzen.
Die Innovationscommunities entwickeln ihr Innovationsthema, neue Transferformate und gestalten ihre zum Transfererfolg benötigten Partnerschaften zielgerichtet und flexibel. Dies stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren und trägt zur Entwicklung innovativer Lösungen für gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen bei.
Thematische Schwerpunkte der 20 Innovationscommunities liegen in sehr unterschiedlichen Bereichen, u.a. Gesundheits- und Sozialwesen, Logistik und Verkehr, Produktions-, Verfahrenstechnik, Kreislaufwirtschaft und Biotechnologie. Bei etwa 40 Prozent der Innovationscommunities geht es um Soziale Innovationen, zum Teil in Verbindung mit technologischen Innovationen.