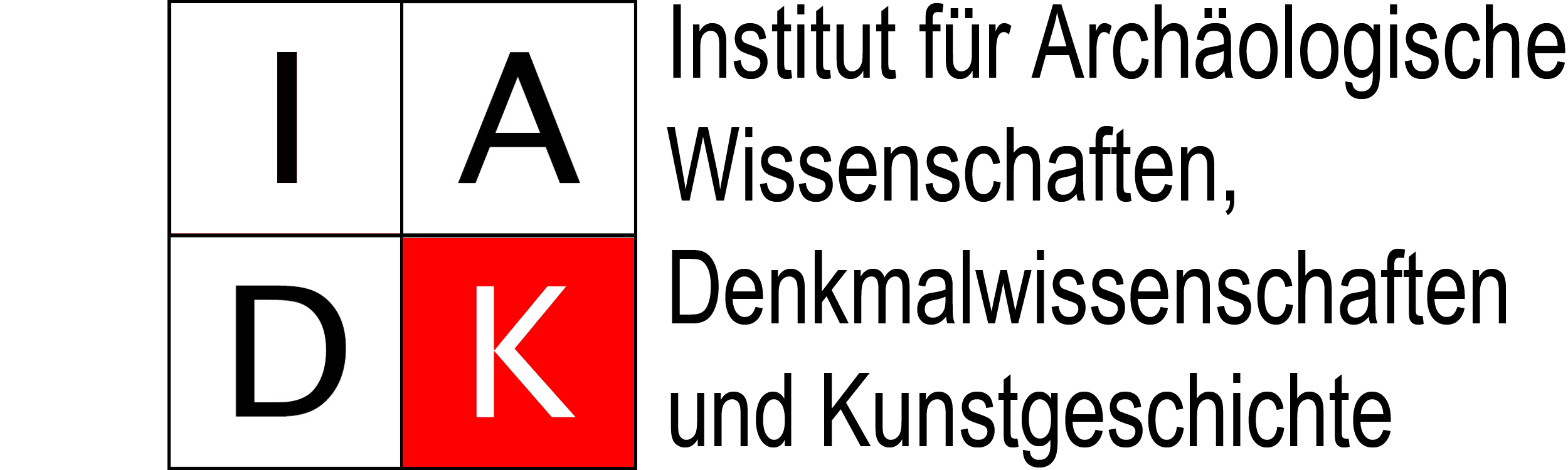Kunsttechnologische Forschungen zur Staffelmalerei der Nazarener
Maltechnik und Materialverwendung in der Malerei des frühen 19. Jahrhunderts
Inhalt und Ziele
Dr. Eva Reinkowski-Häfner untersucht die Entwicklung der Maltechnik im frühen 19. Jahrhundert. Dabei konzentrierte sie sich auf die Malergruppe der Nazarener und deren Rekurs auf die Malerei des Mittelalters und der Frührenaissance. Die Gemeinschaft junger Künstler hatte sich ab 1808 an der Akademie in Wien zusammengeschlossen und sich 1809 den Namen „Lukas-Orden“ gegeben. Sie wollten die Kunst erneuern und ihren Vorbildern Raffael und Dürer und deren Zeitgenossen nachfolgen. Von 1810 bis 1812 lebten sie in Rom zusammen im Kloster S. Isidoro, ein enger Verbund, der aber rasch um neue Mitglieder wie Peter Cornelius und Wilhelm Schadow erweitert wurde. Spätestens ab 1817 wurde der Kreis um Johann Friedrich Overbeck in Rom als Nazarener bezeichnet. Bereits 1818 ging Peter Cornelius zurück nach Deutschland, um die Leitung der Akademie in Düsseldorf und zugleich im Auftrag des Kronprinzen Ludwig von Bayern die Ausmalung der Glyptothek zu übernehmen. Während alle Mitglieder der Künstlergruppe nach Deutschland zurückkehrten, dort Positionen als Akademiedirektoren oder –lehrer bzw. zahlreiche Wandmalereiprojekte übernahmen und dadurch die Malerei dieser Zeit wesentlich beeinflussten, verblieb Johann Friedrich Overbeck zeitlebens in Rom.
Im Fokus der Untersuchung stehen die Anfänge der jungen Maler in Wien und in Rom bis ca. 1840. Zentrale These der Untersuchung ist die Annahme, dass sich die Malergruppe nicht nur mit den Bildideen ihrer Vorbilder, sondern auch mit deren Maltechnik und Materialverwendung auseinandersetzte.
Methode
Grundlage der kunsttechnologischen Untersuchung ist eine Methodenkombination von kunsthistorischer Literatur- und Quellenforschung, inklusive Archivforschung, Konsultation maltechnischer Quellenschriften und die restauratorische Gemäldeuntersuchung mit Oberflächenuntersuchungen der Werke und bildgebenden Untersuchungsverfahren sowie die naturwissenschaftliche Materialuntersuchung und chemische Analysen. Die Gemälde wurden zunächst im Augenschein und mit dem Stereomikroskop untersucht sowie Besonderheiten zu Bildträger, Malschichtenaufbau und Oberflächenerscheinung durch digitale Aufnahmen festgehalten. Der durch die Disziplinen Kunstgeschichte, Restaurierung und Chemie erarbeitete Forschungsstand des frühen 19. Jahrhunderts zur Maltechnik der ‚Alten Meister‘ wurde bereits in der Dissertation „Die Entdeckung der Temperamalerei im 19. Jahrhundert“ von 2014 anhand von Archivmaterial sowie zeitgenössischer kunsthistorischer und maltechnischer Literatur erarbeitet. Neue Literaturrecherchen, die Sichtung von Künstleräußerungen und vor allem die Untersuchung der Gemälde konnten möglichst nahe an die Arbeit im Atelier und an die individuellen Malweisen der Künstler heranführen. Maltechnische Quellenschriften des frühen 19. Jahrhunderts und Recherchen zum Farbenhandel eröffneten den Zugang zur damaligen Materialverwendung und der Verfügbarkeit moderner Pigmente und Bindemittel. Die Auswertung der Diskussion zum Stellenwert verschiedener Maltechniken ermöglicht es, Aspekte der Ästhetik der Kunst der Nazarener zu erhellen.
In 12 Museen wurden 38 Gemälde aus dem Oeuvre der Maler Franz Pforr, Ludwig Vogel, Johann Friedrich Overbeck, Peter Cornelius, Wilhelm Schadow, Johannes Veit und Julius Schnorr von Carolsfeld restauratorisch und naturwissenschaftlich untersucht. Dabei wurden die bildgebenden Verfahren der UV- und IRR-Photographie, der Multispektralphotographie sowie der Röntgenaufnahme eingesetzt. Darüber hinaus konnten zerstörungsfreie Methoden der Pigment- und Bindemitteluntersuchungen mit mobilen RFA- und FTIR-Reflexions-Messgeräten erprobt werden. Querschliffe, Pigment- und Bindemittelanalysen gaben Aufschluss über den Malschichtenaufbau und die Materialverwendung.
Ergänzt wurden diese verschiedenen Ansätze durch maltechnische Rekonstruktionsversuche, die die Eigenschaften von Malmaterialien und die Effekte im Malschichtaufbau und der Oberflächenerscheinung nachstellen und die Ergebnisse aus der naturwissenschaftlichen Analyse und der Auswertung der Schriftquellen malpraktisch verifizieren und interpretieren konnten.
Ergebnisse
Die zentrale Fragestellung des Projektes konnte durch die kunsttechnologischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen dahingehend beantwortet werden, dass sich die jungen Akademieschüler bereits in der Wiener Zeit mit Maltechnik auseinandersetzten. Während Overbeck zunächst an der klassizistischen Maltechnik, wie sie an der Wiener Akademie gelehrt wurde, festhielt, experimentierte Pforr mit Bindemittelkombinationen, die nach der damaligen Forschung der altdeutschen bzw. der altniederländischen Malerei zugewiesen wurden. Zugang zum Forschungsstand konnten die jungen Künstler in der Bibliothek der Akademie erhalten, die beispielsweise Werke wie Luigi Lanzis Storia pittorica dell’ Italia dal risorgimento delle belle arti fin presso al fine del XVIII secolo von 1795 und Johann Dominik Fiorillos Geschichte der zeichnenden Künste von 1798 vorhielt.
Nicht nur die kunstgeschichtliche Literatur, sondern auch das Studium der Originale in den Wiener Galerien ermöglichte den Akademieschülern, die Malweise ihrer Vorbilder zu studieren und in den eigenen Werken umzusetzen. Franz Pforr gestaltete beispielsweise die Ritterrüstung seines Heiligen Georg von 1810 mit braunen Schaffuren über Blattgold und folgte damit der Gestaltung des Harnischs von Wilhelm Haller im Allerheiligenbild (Landauer Altar) von Albrecht Dürer, ein Gemälde, das Pforr damals in der Galerie des Belvederes betrachten konnte.
Overbeck verwendete den klassizistischen Malschichtenaufbau, wie er in Anton Raphael Mengs Praktischer Unterricht in der Mahlerei von 1783 beschrieben wurde, doch entwickelte er diesen weiter, indem er die chiaroscuro-Untermalung in feiner Punktierung auftrug und sich des Weiteren an Leonardo da Vincis Arbeitsweise der Untertuschung mit braunen und grauen Lavuren orientierte.
Nicht vollständig geklärt werden konnte, woher die jungen Schüler in Wien Anregung bzw. Anleitung zu den maltechnischen Experimenten erlangen konnten, da die Akademie dies - nach bisherigem Forschungsstand - nicht anbieten konnte. Maltechnisches und handwerkliches Wissen könnte Josef Wintergerst, Gründungsmitglied des Lukas-Ordens, seinen Mitbrüdern vermittelt haben, da er „in seinen früheren Jahren […] bei seinem Vater, der ein Maler in einem Dorf war, vergolden, lackieren und anstreichen“ lernte. Zudem war die Rezeption der Kunst und der Maltechnik des Mittelalters seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ein international diskutiertes Thema, das zunächst literarisch aufgegriffen, dann aber auch wissenschaftlich durch die neuen Disziplinen der Kunstgeschichte, der Restaurierung und der Naturwissenschaften bearbeitet wurde. Auch in Wien gab es ein reges Interesse an der Kunst des Mittelalters, wie der Wiener Hof durch den Bau und die Ausstattung der Franzensburg in Laxenburg zeigte. Aber auch die Wiener Akademie äußerte als oberste Kulturbehörde ein wissenschaftliches Interesse an den historischen Maltechniken, insbesondere am Alter der Ölmalerei. Sie hatte Bindemitteluntersuchungen an einem Gemälde des Tommaso da Mutina durchführen lassen, um zu klären, ob das Gemälde in Öl oder in Tempera ausgeführt war.
Den Mut, sich maltechnischen Experimenten zu widmen, konnten die Lukasbrüder aus dem Missstand eines defizitären Unterrichtsangebots an der Akademie ziehen. Dort war zwar von 1803 bis 1806 ein Malunterricht unter dem Direktor Heinrich Füger angeboten worden, doch wurde dieser aufgegeben, als Füger Direktor der Galerie im Belvedere wurde. Die Lehre muss gerade in der Zeit von 1806 bis 1810 altbacken, aber auch mangelhaft gewesen sein, bedingt durch den reduzierten Lehrkörper, durch die Akademieschließungen wegen der napoleonischen Besatzungen und durch die verstärkte klassizistische Ausrichtung Franz Anton Zauners, ab 1806 Direktor der Schule für Malerei und Bildhauerei, der kein Maler, sondern Bildhauer war.
Spannend ist die Tatsache, dass Pforr zwar mit historischen Maltechniken experimentierte, aber bei den Pigmenten gerne moderne brillante Farben einsetzte, wie beispielsweise das Kobaltblau nach Leithner (Kobalt-Arsen-Verbindung) oder das Kobaltblau nach Thenard (Kobalt-Aluminium-Verbindung), das damals ganz neu auf dem Markt war. Hier zeigt sich der Wille der Lukasbrüder, die Malerei zu erneuern, nicht nur durch einen maltechnischen Historismus, sondern auch durch den Einsatz moderner Materialien.
Als die Lukasbrüder 1810 nach Rom zogen, trafen sie dort auf ein bereits reges Interesse an der Maltechnik der alten Meister. Neben den bereits bekannten Bestrebungen konnten die jungen Künstlern Informationen über historische Maltechniken durch das Studium der originalen Gemälde sowie ab 1813 durch das Werk „Saggio analitico“ von Lorenzo Marcucci erlangen, der die frühe florentinische, römische und venezianische Ölmalerei beschrieb und das Traktat „De veri Precetti della Pittura“ von Giovanni Battista Armenini von 1586 auswertete. Overbeck legte erst in der römischen Zeit den klassizistischen Malschichtenaufbau ab und führte dann Gemälde auch unter der Verwendung von „Tempera“ aus.
Anwendungsbezug, gesellschaftliche Relevanz, Nutzung der Ergebnisse
Die Untersuchung ist ein Beitrag zur Geschichte der Maltechnik des 19. Jahrhunderts. Hier wird vor allem die vermeintliche Technikfeindlichkeit der Lukasbrüder und Nazarener hinterfragt. Eindeutig zeigt sich auch, dass es keine einheitliche Malweise in der Künstlergruppe gab, sondern individuelle Wege und Ausrichtungen gewählt wurden.
Der vorliegende umfangreiche Bestand digitaler Photographien in unterschiedlichen bildgebenden Verfahren ermöglicht weitere kunsthistorische und kunsttechnologische Forschung. Die Dokumentation maltechnischer Phänomene und Oberflächen-erscheinungen erlaubt einen Vergleich von Werken, aber auch eine Katalogisierung phänotypischer Merkmale bestimmter Maltechniken. Die erzielten Erkenntnisse zu den technischen Voraussetzungen der Kunstwerke sollen die Planung restauratorischer Eingriffe erleichtern sowie bessere Aussagen über das individuelle Verhalten von Bildern (z.B. individuelle Klimasensibilitäten) und Vorgaben im Sinne der präventiven Restaurierung ermöglichen.
Bamberger Kompetenzen
Das Projekt profitierte von der Möglichkeit, den Schwerpunkt des Lehrstuhls für neuere und neueste Kunstgeschichte sowie die Einrichtungen, Geräte und die Expertise des Kompetenzzentrums für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien, insbesondere für die Materialanalyse zu kombinieren.
Publikationen zum Projekt
- Separating Form and Colour: Johann Friedrich Overbeck's Technique of Underpainting in Chiaroscuro. In: Doris Oltrogge (Hg.), Work in Progress. Explorer gestes et savoir-faire artistiques à travers les sources de la technologie de l’art. ICOM-CC, ATSR Conference Paris 2022. Köln 2024.
- „die gute Zubereitung der Farbe, das Mischen derselben, deren Traktament und einen guten Colorit“. Die frühe malerische Praxis der Lukasbrüder in Wien: zwischen Akademie- und Selbststudium. In: E. Reinkowski-Häfner, A. Bastek (Hg.), Die Lukasbrüder in Wien. Akademieausbildung, Mittelalterrezeption, Maltechnik. Petersberg: Imhof 2023, S. 23-138.
- „chimische Waaren“. Farbenproduktion und -handel in Wien um 1800. In: E. Reinkowski-Häfner, A. Bastek (Hg.), Die Lukasbrüder in Wien. Akademieausbildung, Mittelalterrezeption, Maltechnik. Petersberg: Imhof 2023, S. 139-164.
- Wilhelm Schadows „Kamaldulenser-Mönch“ und Friedrich Müllers Kopie in Porzellanmalerei: eine Untersuchung der Maltechniken. In: N. Fleck, C. Grewe (Hg.), Schön wie ein Schadow. Friedrich Müllers Fortunata-Porträt im Kontext. Petersberg: Imhof 2021, S. 78–97.